Mar Gabriel Verein - Mitteilungsblatt 2004
Patriarchen, Propheten, Mönche und
Moslems
Türkeireise des Lehrhauses Bremen vom 11. bis 25. 10. 2003
Fortsetzung
An der breiten Straße, die auf
Mardin zuführt, wird rechts gerade geböllert. Man begrüßt ein
Brautpaar. Aus dem nachmittäglichen Dunst tritt langsam die
Stadt Mardin hervor. Sie scheint am Berg zu hängen. Doch
die idyllische Lage täuscht, hier gibt es nicht nur die nahezu
biblische „Stadt auf dem Berge“, sondern auch die raue
Gegenwart. Die macht sich in den großen Kugeln oberhalb der Burg
fest. Die Amerikaner horchen von hier oben mit ihren Antennen
nach Syrien und dem Irak hinein. Und auch das Hotel mit Blick in
die Weite der syrischen Ebene ist nur für sie reserviert.
Unser Touristenhotel liegt in der
Neustadt, auf der anderen Seite des Berges. Gegessen wird jedoch
in einem wunderschönen Altstadthaus, in dem sich eine
Einheimische mit ihrem Restaurant selbstständig gemacht hat. Von
dessen Terrasse aus genießen wir des Abends den Blick über die
Ebene nach Syrien hin.
Der Ort selbst hat vermutlich
durch seine „moderne“ Bautätigkeit im 20. Jahrhundert viel von
seinem einstigen Reiz verloren. Nur noch ab und an sieht man die
aus Natursteinen gebauten und mit verzierten Fenster- und
Türrahmen versehenen alten Häuser. Dazwischen geistlose
Betongerüstbauten. Heute pflegt und renoviert man die alten
Bauten wieder zwischen denen eine Reihe ehrwürdiger Moscheen wie
alter Kirchen zu finden sind. Am Busparkplatz mitten in der
Altstadt fällt der Blick auf das ehemalige Gebäude des
syrisch-katholischen Patriarchats. Der Patriarch residiert heute
in Beirut. Sein Palais wird jetzt als Museum genutzt.
Uns zieht es jedoch zum
Kloster Deir ez-Zafaran, einem Bau, der auf die Zeit des
Kaisers Anastasius (491 – 518) zurückgeht und der von 1166 bis
1932 mit Unterbrechungen der Sitz des syrisch-orthodoxen
Patriarchen ist. Nach 1933 residieren sie zunächst in Homs;
heute in Damaskus.
Von Cem Göncü, unserem
Reiseagenten aus Urfa, mit traditionellem Gebäck aus Mardin
versorgt, verlässt der Bus den Ort in Richtung Osten. Ein paar
Kurven und schon ist das Kloster unterhalb einer Bergwand
auszumachen. Ein neues Tor wird durchfahren und der Bus hält
unweit des Eingangs. Auf der Treppe kommt uns der junge,
dynamische Abt Gabriel lächelnd entgegen. Er verabschiedet noch
schnell ein paar einheimische Besucher - es ist schließlich
Sonntag - und dann ist er ganz für uns da. Nach der Begrüßung
führt er uns zunächst in die Kirche aus dem fünften oder
sechsten Jahrhundert. Es ist ein quadratischer Bau mit drei
Konchen. In der östlichen befindet sich der Chor mit dem Altar
aus dem Jahre 1941. Die beiden anderen sind für die Sängerchöre
geschaffen. Am Eingang der Chorkonche stehen zwei
Patriarchenthrone. In der Rückwand des linken sind die Namen
aller syrisch-orthodoxen Patriarchen von Antiochien eingetragen,
angefangen beim Apostel Petrus. Darauf legen die Aramäer großen
Wert, dass die Kirche von Antiochien auf den Heiligen Petrus
zurückgeht; wie Rom. Ja, dass die „Jesuaner“ in Antiochien
erstmals Christen genannt werden. An den beiden verzierten
Säulen neben den Thronen hängen zwei Bischofsstäbe. Der linke
ist ein westlicher Krummstab, der rechte, ein ostkirchlicher
Stab mit den beiden Schlangenhäuptern.
Der Abt fragt, ob wir in der
Kirche Gottesdienst feiern wollen. Er stellt sie uns umgehend
zur Verfügung, als wir bejahen. Danach erscheint er wieder, um
uns die Geschichte des Klosters zu erzählen, uns Rede und
Antwort zu stehen und durch das Kloster zu führen. Da er sich
auf Anhieb mit Ünal, unserem Reiseführer, der übersetzen muss,
gut versteht, kommt es zu einem informativen Dialog, der auch
die nicht einfache Lage der Christen in gegenseitigen
Frotzeleien durchscheinen lässt. Ein wenig konsterniert schauen
sich jedoch einige Lehrhäusler an, als der Abt für den fehlenden
Priesternachwuchs die fehlenden Heimchen am Herd verantwortlich
zu machen versucht.
Nach dem Gespräch geht es in
der Grabkapelle an der Südseite der Kirche. Hier wurden
syrisch-orthodoxe Patriarchen der Sitte gemäß auf einem Thron
sitzend begraben. Die Marienkirche auf der Nordseite hinterlässt
wegen ihrer Unberührtheit einen großen Eindruck. Durch die
königliche Pforte in der steinernen Trennwand zum Chor fällt der
Blick auf einen einfachen Steinaltar. Er ist von einem alten
hölzernen Baldachin mit geometrischer Verzierung und aramäischer
Inschrift überwölbt. Das uralte Taufbecken ist achteckig. Acht
ist das Zeichen der Vollkommenheit wie der Auferstehung. Im
Becken erleben die Kinder beim Untertauchen Tod und Auferstehung
symbolisch mit. Nackt in das Wasser getaucht und danach mit Öl
gesalbt, das bedeutet, dass der Täufling mit Christus dem
Gesalbten „bekleidet“ wird.
Eine alte Sänfte, in der der
Patriarch von Pferden getragen reiste, lässt die Gedanken in
frühere Zeiten schweifen, in denen Bus und Flugzeug noch nicht
selbstverständlich waren.
Bewundernde Blicke zieht die Decke
der Krypta auf sich. Sie gehört wie der ganze Raum der
Überlieferung nach zu einem über 2000jährigen heidnischen
Tempel. Ihn hat das Kloster im 5./6. Jahrhundert überbaut. Die
Decke aus rechteckigen Steinblöcken überstand bisher jedes
Erdbeben, denn sie sind so angebracht, dass sie ineinander
verkeilt sind.
Das Kloster macht insgesamt einen
guten Eindruck im Gegensatz zu vor dreißig Jahren; und zwar
nicht nur von außen, sondern auch von innen. Dazu haben nicht
wenig die Gastarbeiter beigetragen, die nicht nur aus
wirtschaftlichen Gründen ihre angestammte Heimat verließen, sie
aber keineswegs vergessen haben.
Kurz vorm Dunkelwerden wird nach
einer Stippvisite in die in goldenes Sonnenlicht getauchten
Sultan-Kasim-Medrese noch die syrisch-orthodoxe Kirche der
vierzig Märtyrer von Sebaste in Mardin besucht. Sie ist
heute das kirchliche Zentrum des Orts und Sitz eines mit dem
Titel Chorbischofs ausgezeichneten verheirateten Priesters.
Insgesamt gibt es fünf Kirchen in Mardin, in denen die übrig
gebliebenen 70 syrisch-orthodoxen Familien im sonntäglichen
Wechsel ihre Gottesdienste feiern. Eine der Kirchen ist
chaldäisch und eine syrisch-katholisch. Da es aber nur noch eine
syrisch-katholische Familie am Ort gibt, nimmt sie an den
orthodoxen Gottesdiensten teil und öffnet ihre Kirche für
denselben.
In der Kirche der 40 Märtyrer von
Sebaste lernen wir erstmals syrische Ikonen kennen. Sie sind
nicht sehr alt. Ihr Stil ist naiv, aber dennoch eindrucksvoll.
Auf zweien wird die Geschichte des Martyriums der vierzig
Märtyrer unter Kaiser Licinius im 4. Jahrhundert dargestellt.
Sie mag den syrischen Christen ein Trost in schwerer Zeit
gewesen sein, schildern die zwei Ikonen doch die Standhaftigkeit
von 40 Männern, die lieber nackt auf einem zugefrorenen See
sterben, als, wie vom Kaiser gewünscht, ihrem Glauben
abzuschwören. Nur einer wird weich. Er flüchtet sich in die
angeheizte Badestube. Ein römischer Soldat macht die Zahl der
vierzig dann wieder komplett, weil er, überwältigt von der
Standhaftigkeit seiner christlichen Kameraden, sich auskleidet
und nackt auf den See begibt. Hat dieses Bild nicht Ähnlichkeit
mit ihrer Situation?
Auf anderen Ikonen sind ein paar
syrische Heilige dargestellt, meistens Mönche. Sie waren in der
Geschichte der Aramäer die Lehrer ihres Volks und die Garanten
der Überlieferung des Glaubens. Die skurrilste Ikone zeigt den
Mor Malke, einen Mönch, der die Tochter des Kaisers Konstantin
vom Teufel befreit. Der dankbare Kaiser will ihm daraufhin jeden
Wunsch erfüllen. Mor Malke verlangt jedoch nur nach einem Stein,
mit einem Loch in der Mitte. Den lässt er vom Teufel in sein
Kloster tragen. Auf der Ikone führt er einen kleinen Teufel wie
einen Hund an der Kette. Bewundert werden jedoch auch der
silberbeschlagene Tabernakel sowie die modernen Vorhänge. Zum
Schluss trägt uns der Priestersohn das „Vater unser“ auf
Aramäisch vor.
Am nächsten Tag geht es weiter
ostwärts zum legendären Tur Abdin, dem „Berg der
Gottesknechte“. Diese Gegend im Grenzgebiet zu Syrien wird
wegen der vielen Mönche so genannt, die hier seit dem 4.
Jahrhundert ihre Klöster bauen. Dies mit Krüppelkiefern
bestandene hügelige Gebiet ist urchristlicher Boden, denn
bereits Anno 120 n. Chr. ist hier ein erster Bischof
nachgewiesen. Heute sind viele der Klöster verlassen oder gar zu
Ruinen verfallen. Zentrum des Tur Abdin ist heute das Kloster
Mor Gabriel, von der aus der syrisch-orthodoxe Erzbischof
Timotheus Samuel Aktas seine klein gewordene Diözese leitet.
Wir streifen auf unserem Weg zum
Kloster zunächst das Städtchen Midyat. Die
minarettähnlichen Kirchtürmchen seiner vier christlichen
Gotteshäuser nehmen wir im Vorbeifahren wahr. Wir stellen auch
fest, dass die Kreuze erst im letzten Augenblick zu erkennen
sind. Sie sind aus Eisenbändern geformt. Zufall oder Absicht?
Jedenfalls künden die kleinen Glocken im Turm davon, dass das
Läuten nicht verboten ist.
Während man über derlei nachdenkt,
ist der Bus schon auf dem Weg zum rund 20 km entfernten Kloster;
auf guter Straße. Sie ist ein Zeichen dafür, dass auch die
türkischen Behörden begriffen haben, dass das Kloster ein Ass in
Punkto Tourismus ist. Es steht seit langen auf den Programmen
von Rundreisen in den Osten der Türkei.
Unter Umständen lässt sich
Erzbischof Timotheus auch deshalb nicht von seinem Gang aufs
Feld abhalten, als unser Bus durchs Tor vor den Klostereingang
fährt. Touristengruppen können schließlich auch nerven. Ich
entdecke den Erzbischof jedoch im Vorbeifahren, denn seine rote
Soutane und sein schwarzer Mönchsschleier mit den 13 gestickten
Kreuzen darauf verraten ihn. - Das große Kreuz im Nacken
erinnert an Christus, die jeweils sechs kleinen zur rechten und
linken Seite des vorderen Kopfes symbolisieren die 12 Apostel.
Deutlicher kann man wohl nicht zeigen, in wessen Nachfolge man
agiert und wer einem sozusagen wortwörtlich im Nacken sitzt. –
Ich gehe dem Erzbischof nach. Denn
auf die Begegnung mit ihm haben besonders Karl Küpper und ich
uns gefreut. Karl Küpper hat die Gruppe zuvor mit der
syrisch-orthodoxen Kirche vertraut und sich selbst durch einen
Besuch im syrischen Kloster in Warburg und in der Gemeinde in
Delmenhorst schlau gemacht. Ich finde den Erzbischof vorm
Klostertor, wo er sich auf einem Feld umsieht, wie weit die
Arbeiter mit dem Bau einer Mauer sind. Die arabische Anrede
„Sayyidna“ - „Monsignore“ - lässt ihn zunächst noch ein wenig
kühl zur Seite schauen. Doch als ich ihn bitte, zurück ins
Kloster zu kommen, da ihn dort zwei hohe Gäste erwarteten, muss
ich den Metropoliten nicht zweimal bitten. Seine Minen hellen
sich zusehends auf, als ich ihm Fotos von seinem Vorgänger
zeige. Ich habe sie mitgebracht, um ihm zu beweisen, dass ich
vor dreißig Jahren bereits einmal Gast im Kloster war. Sein auf
dem Foto abgebildeter Vorgänger habe nur ein Jahr regiert,
erzählt der Erzbischof. Er sei in Holland bei einem
Verkehrsunfall umgekommen. Im Weitergehen holt der Erzbischof
sein silbernes Brustkreuz aus der Hosentasche und legt es sich
um. Ich nehme das zufrieden zur Kenntnis. Inzwischen erreichen
wir beide die Gruppe im Kloster.
Dort stelle ich dem Erzbischof
neben dem „Primeminister“ Dr. Henning Scherf auch den Münchener
Theologieprofessor Dr. Reinhard Hübner vor. Bei ihm hat der Abt
Juhanna Aydin vom Kloster Mor Jakob von Sarug in Warburg
studiert. Der Erzbischof kennt ihn selbstverständlich, kommt er
doch auch aus dem Tur Abdin.
Nach kurzem Smalltalk überlässt
Erzbischof Timotheus, immer noch ein wenig reserviert, die
Gruppe einem Schüler mit dem Hinweis, das sei sein bester
Klosterführer. Das Kloster hinterlässt vor allem bei mir einen
guten Eindruck. „Das hat vor 30 Jahren hier noch ganz anders
ausgesehen“, verkünde ich der Gruppe. Überrascht bin ich vor
allem vom hervorragenden Zustand der Hauptkirche des Klosters.
„Das war vor dreißig Jahren ein dunkles Loch“.
Die Stimmung des Erzbischofs hellt
sich auf, als ich ihn beim abschließenden Treffen im
Empfangsraum frage, was denn aus dem jungen dynamischen Abt des
Klosters mit dem Clergyman geworden sei, der zuvor in New York
studiert und mich und meine Gruppe damals so herzlich empfangen
habe. Der Erzbischof lacht schallend und klopft mir auf die
Schulter: „Der bin ich“, sagt er. „Mein Bart ist ein wenig
grauer geworden“, fügt er lächelnd hinzu und zupft zufrieden am
ihm. Er sitzt dabei auf einem prächtigen Stuhl neben dem etwas
größeren Thronsessel, der für den Patriarchen reserviert ist.
Dessen Bild hängt über der Eingangswand. Über dem Thron hängt
neben dem Bild des Patriarchen auch eines vom türkischen
Staatspräsidenten.
Während des Gesprächs taut der
Erzbischof nach und nach richtig auf, zumal es glücklicherweise
in Englisch geführt wird. Und als Ünal den Raum verlässt, um zu
rauchen, gewinnt es an Deutlichkeit. Der Erzbischof nimmt nun
kein Blatt mehr vor dem Mund. Und er macht einen resignierten
Eindruck. Er verschweigt nicht, dass er mit der Lage der
Christen in der Türkei nicht zufrieden ist. Von
Gleichberechtigung könne keine Rede sein. Zu viele seiner
Gläubigen haben die Gastarbeiterwelle genutzt und sind nach
Westeuropa ausgewandert. Oft ganze Dörfer. „Einige kommen
wieder, nicht nur zu Besuch, sondern sie bleiben hier“, sagt er
mit Zufriedenheit in der Stimme. Das werde von den staatlichen
Stellen auch gefördert. Nur, ihre Häuser seien inzwischen von
anderen bewohnt. Von moslemischen Kurden vermutlich. Wie viele
zurückkommen, sagt der Erzbischof nicht. Ginge es nach seinen
Wünschen, wären es mehr. Auch die Frage nach der Zahl seiner
Gläubigen bleibt unbeantwortet.
Wie er den Umbau gemanagt habe,
frage ich ihn. Ich spiele dabei darauf an, dass in der Türkei an
sich Umbauten und Restaurierungen von Kirchen nicht gestattet
sind. „Wir haben es einfach gemacht“, antwortet der Erzbischof
schmunzelnd. Er fügt hinzu: „Wir haben hier einen guten
Gouverneur. Und in Midyat auch. Der sagt: Macht nur!“ Und der
Erzbischof macht´s. - Da der Gouverneur vermutlich um den
touristischen Wert des Klosters weiß, drückt er beide Augen zu,
kann man vermuten. - Allerdings geschieht das alles ohne, dass
der Staat einen einzigen Kurus beisteuert. Die Religionsbehörde
in Ankara unterstütze nur die Restauration islamischer Gebäude,
und zwar nur sunnitischer, sagt er beinahe ein wenig wütend. Für
andere gebe es keine müde Lira, merkt er sauer an.
Ähnlich wird auch das Problem mit
der Schule gelöst. Die wiederholten Bitten des Erzbischofs, im
Kloster eine Schule errichten zu dürfen, um die Weitergabe des
Glaubens wie der eigenen aramäischen Sprache zu sichern, wird
konstant abgelehnt. Auf die erstaunte Frage einer Lehrerin, wozu
man im Kloster dann vier Lehrer brauche, erwidert der
Erzbischof, man habe im Kloster ein Internat für Jungen
eingerichtet. Dorthin kämen sie zurück, wenn sie vormittags in
Midyat die staatliche Schule besucht hätten. Am Nachmittag
stünden die Lehrer „zur Nachhilfe“ bereit. Der Erzbischof muss
das zweimal erklären, bevor bei den Bremer Lehrerinnen der
Groschen fällt. Eine typisch orientalische Lösung. Jeder wahrt
sein Gesicht.
Als ich ihn frage, ob und wie wir
ihm helfen könnten, bricht es förmlich aus ihm heraus: „Fordert
Gleichbehandlung!“ sagt er spontan und erläutert: „Wenn Ihr bei
Euch Moscheen bauen lasst, fordert, dass die Kirche hier genauso
behandelt wird“.
- In einem Schreiben an die
Regierung in Ankara haben die Religionsführer der griechisch-,
armenisch- und syrisch-orthodoxen Kirche jüngst gerade einen
gesicherten Rechtsstatus gefordert, Priesterseminare sowie
Gotteshäuser in allen türkischen Städten, in denen Christen
leben. -
Er habe erst jüngst die
Botschafter von den Niederlanden und anderer europäischer Länder
bei Besuchen im Kloster ermutigt und gedrängt, darauf zu
bestehen, dass die Türkei Touristenseelsorger ins Land lasse,
erzählt der Erzbischof. „Die Regierung verweigert das“. Der
Erzbischof scheint nicht zu wissen, dass der Drang der
türkischen Regierung, in die EU aufgenommen zu werden, seinem
Wunsch jüngst entsprach. Erstmals wurde einem deutschen
Touristenseelsorger eine Arbeitserlaubnis gewährt, wie man nach
der Rückkehr im Kirchenboten lesen konnte. Er musste nicht mehr
unter dem Deckmantel des Diplomaten einreisen. Denn häufig
agiert die Kirche unter diplomatischem Schutz, weil es anders
nicht geht.
Auf der Weiterfahrt in Richtung
Diyarbakir gibt es noch einen Zwischenstopp im einstigen
Christenviertel von Midyat. Das Städtchen bestand bis vor
ein paar Jahrzehnten noch aus einem islamischen und einem
christlichem Stadtteil. Zwischen beiden gab es eine unbebaute
Fläche von rund einem halben Kilometer. Die existiert heute
nicht mehr. Sie ist inzwischen zugebaut, denn auch der
christliche Stadtteil wird nach dem Exodus der Gastarbeiter
nicht mehr ausschließlich von Christen bewohnt. Bereits vor
dreißig Jahren konnte ich dort eine Familie besuchen, an deren
Wänden noch die christlichen Bilder der Vorbesitzer hingen. Die
jetzigen Bewohner waren jedoch Moslems.
Wir besuchen von den vier Kirchen
in Midyat lediglich die Mor Barsaumo-Kirche am Ortseingang. Sie
ist eine der schönsten syrisch-orthodoxen Kirchen, die wir auf
unserer Reise kennen lernen. Durch ein prächtiges Portal
unterhalb eines filigranen Glockenturms geht es in einen
basilikalen Raum, dessen Mittelschiffgewölbe mit einem großen
dunklen Kreuz bemalt ist. Zu den Kostbarkeiten gehört ein
silberbeschlagenes Evangeliar. Beim Gang zum Bus fällt mir der
riesige Moscheeneubau auf, der direkt vor der Grenze zum
ehemaligen Christenviertel entsteht. Hier werden architektonisch
die Besitzverhältnisse klar gemacht.
Im Anschluss an den Kirchenbesuch,
betreiben einige Lehrhäusler ihre ganz persönliche Form der
Wirtschaftsförderung: Sie decken sich bei einem christlichen
Goldschmied mit Silberschmuck ein. Das Feilschen darum wie das
Warten darauf geht ein paar Puristen zeitlich wiederum zu weit.
Sie revanchieren sich, als bei
Hasankeyf der Tigris überquert wird. Sie erkämpfen sich den
zeitlichen Ausgleich fürs Warten beim Goldschmied, indem sie
sich ganz persönlich intensiv mit Tigriswasser benetzen, während
andere sich mit sehnsüchtigen Blicken von oben begnügen und mit
lautem Rufen die Tigriswallfahrer zur Rückkehr ermuntern. Wie
auch immer: Der Anblick des hier noch recht mickrigen Tigris
nebst ruinierter antiker Brücke möge den Touristen zum
Fotografieren oder zum Benetzen am Ufer noch lange erhalten
bleiben. Wie der Direktor des Atatürkstaudamms behauptete, habe
sich nämlich der Plan eines Tigrisstaudamms unterhalb von
Hasankeyf bisher zerschlagen. Sein Wort in Allahs Ohr. Denn mit
Hasankeyf würde ein Ort für immer unter Wasser versinken, der
von den Römern als Grenzort zum persischen Reich gegründet wurde
und dessen Brückenreste zumindest auf das 12. Jahrhundert
zurückgehen. Vermutlich sind sie aber noch älter, wird sie doch
1116 bereits restauriert.
Eine angeblich römische Brücke
über den Tigris können wir von den Stadtmauern von Diyarbakir
in der Ferne ausmachen. Ihr Erbauer ist jedoch laut Prof. Dr.
Hans Hollerweger der syrisch-orthodoxe Bischof Johannes Saoro
von Amida (Diyarbakir), vormals Abt des Klosters Mor Gabriel.
In Diyarbakir selbst beeindrucken
uns die beinahe komplett vorhandenen Stadtmauern aus schwarzem
Stein, von deren Keci-Burcu Bastion am Mardin-Tor wir den Blick
über das grüne Vorland zum Tigris schweifen lassen. Der in ein
Hotel umgebaute Deliller Han lädt mit seinem schattigen Innenhof
zu einer Trinkpause, bevor auf dem Rückweg im Dämmerlicht noch
bewundernde Blicke die Ulu-Camii nebst der beinahe
Renaissance-Fassade der Mesudiye Medrese treffen. Die Ulu-Camii
selbst ist ein Beispiel für die anfängliche Toleranz der
islamischen Eroberer. An dieser Stelle stand nämlich die von
Kaiser Heraklios um 628 umgebaute St.-Thomas-Kirche aus dem
Anfang des 5. Jahrhunderts. Wie in der Omajjadenmoschee in
Damaskus nutzten Christen und Moslem die Kirche zunächst
gemeinsam. Um 770 sollen die Christen ein Drittel und die
Moslems zwei Drittel inne gehabt haben. Wie lange diese
religiöse Koexistenz dauert, ist unklar. Klar ist jedoch, 1115
fallen 200 Säulen der Moschee um. Von Kirche ist damals nicht
mehr die Rede. Die Moschee entsteht danach mit dicken Pfeilern
neu. Zahlreiche Säulen schmücken hingegen die Wände der Bauten
um den Moscheehof.
Eine
syrisch-orthodoxe Marien-Kirche gibt es auch heute noch in
Diyarbakir. Sie wurde jedoch Anfang 2003 „geplündert“, wie die
syrisch-orthodoxe Zeitschrift „Mardutho D-Suryoe“ berichtet.
|
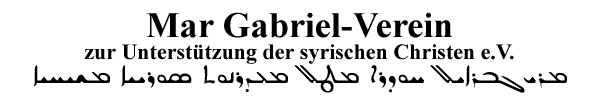
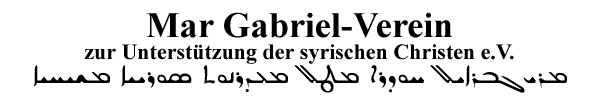
![]()