Mar Gabriel Verein -
Mitteilungsblatt 2002
Die
Türkei auf dem Weg nach Europa -
Eine Besserung für die Minderheiten in Sicht?
- Dr. Rainer Hermann -
Dr.
Hermann ist Korrespondent der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung in Istanbul. Der hier veröffentlichte
Text wurde von ihm als Vortrag bei der 10. Tagung
der Solidaritätsgruppe Tur Abdin in Würzburg,
am 8. Februar 2002 gehalten.
B-shem abo, w abro, w ruho hayo qadisho, hadh
aloho shariro. Amen.
"Im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes, des einen Gottes. Amen."
Sehr geehrte Damen und Herren,
in Europa verstehen heute ungleich mehr diese
Sprache, die auch die des Jesus von Nazareth
gewesen war, als in der Heimat dieses aramäischen
Dialekts. Sie wissen es besser als ich: In den
sechziger Jahren hatten in 55 Städten und Dörfern
des Tur Abdin noch mehr als 60.000 syrisch-orthodoxe
Christen gelebt. Heute sind es gerade 2300.
Unbewohnt sind 30 Dörfer und zehn Klöster;
nicht mehr benutzt werden hundert Kirchen. In
Istanbul leben 12.000 syrisch-orthodoxe Christen,
in Deutschland aber 50.000 und in Schweden sogar
70.000. Die meisten von ihnen waren aus der Türkei
gekommen. Und in ihrer neuen Heimat haben sie
mehr Möglichkeiten, ihre Kultur und ihre Sprache
zu bewahren als in ihrer alten Heimat.
Zu tun hat das mit drei Gründen:
(1) Mit Lausanne: Die syrisch-orthodoxen Christen
der Türkei können nicht auf die Privilegien zurückgreifen,
die der Vertrag von Lausanne aus dem Jahr 1923
Griechen, Armeniern und Juden gewährt.
(2) Mit dem Islam in der Türkei: Alle Christen
in der Türkei leiden darunter, dass die Türkei
weiter unsicher ist in ihrem Umgang mit den
Muslimen, dass die säkulare Türkei mehr Angst
hat vor dem Islam als vor den Christen, dass sie
sich durch Saudi-Arabien und Iran gefährdet
sieht.
(3) Mit einem Geburtsfehler der modernen Türkei:
Denn entstanden ist die Republik in einem für
die Türkei existentiellen Kampf gegen die
Kolonial- und Großmächte. Seither sieht sie
sich von Feinden umgeben, die angeblich nichts im
Sinn haben sollen, als die Republik zu spalten.
Die Frage, die wir uns stellen, lautet: Kann die
Annäherung der Türkei an Europa zu
Verbesserungen führen, die diese Faktoren
aufwiegen oder zumindest aufweichen? Blicken wir
auf die drei Faktoren.
Der erste Faktor: Der Vertrag von
Lausanne
Mit dem Vertrag von Lausanne wurde die Türkei
als Nachfolgestaat des Osmanischen Reichs in die
internationale Völkergemeinschaft aufgenommen.
Unterzeichnet wurde er am 24.7.1923. Artikel 37
bis 45 regeln den Status der nichtmuslimischen
Minderheiten in der Türkei. Artikel 40 räumt
ihnen das Recht ein, eigene Schulen zu errichten
und zu betreiben, Artikel 41 erlaubt in diesen
Schulen die Verwendung der eigenen Sprache.
Der Vertrag nennt die Minderheiten nicht, die in
den Genuss dieser Rechte kommen. Unter Berufung
auf den Vertrag können Griechen, Armenier und
Juden von den Rechten Gebrauch machen. Nicht aber
die syrisch-orthodoxen Christen. 1923 hatte der
damalige syrisch-orthodoxe Patriarch, Ilyas
Shakir Alkan, entschieden, es sei besser für die
Syriani, als gewöhnliche Bürger der neu gegründeten
Türkei nicht aufzufallen und sich nicht als
Minderheit zu exponieren.
Die Weisheit dieser Entscheidung mag heute
umstritten sein. Der Sitz des Patriarchats, der
seit 1293 im Kloster Deir ez-Zafaran gewesen war,
wurde nach dem Tod des Patriarchen Ilyas 1933
nach Homs verlegt. Dort hatte sein Nachfolger
Ignatius Ephrem zuvor bereits als Bischof amtiert.
1959 kam der Sitz nach Damaskus. Patriarch Ilyas
selbst starb während einer Reise nach Indien, wo
in der Region Kerala 2,5 Millionen syrisch-orthodoxe
Inder leben. Überwiegend stammen sie von den
vierhundert Familien ab, die um 300 n. Chr. aus
Urfa ausgewandert waren. Noch immer pflegen sie
ihre damalige Liturgie.
Zurück zur Entscheidung des Patriarchen Ilyas.
Anders als die Griechen, Armenier und Juden
vertrat er eine Glaubensgemeinschaft, die auf dem
Lande lebte, im Tur Abdin, und die so gut wie
keinen Bezug nach Istanbul hatte. Im Tur Abdin
haben einige Regeln die Zeit überdauert. Eine
war die Gefährdung durch die kurdischen Großgrundbesitzer,
die nach den Ländereien der Christen schielten.
Zur Zeit des Ersten Weltkriegs versetzten zudem
die kurdischen Sondereinheiten der Hamidiye Alayi
auch den Tur Abdin in Schrecken. Patriarch Ilyas
war daher der Überzeugung, es sei nicht
opportun, sich in dieser Region als Minderheit
weiter zu exponieren.
Eine Rolle, weshalb die syrisch-orthodoxen
Christen nicht in den Kreis der offiziellen
Minderheiten aufgenommen worden sind, mag auch
gespielt haben, dass in Lausanne die europäischen
Mächte die syrisch-orthodoxe Kirche nicht
beachtet hatten. Sie kannten sie ja nicht aus
Istanbul. Noch 1923 konnte die syrisch-orthodoxe
Kirche keine Rückendeckung aus Istanbul erwarten.
Erst mit einer kleinen Gemeinde hatte sie dort Fuß
gefasst. Seit 1864 besitzt sie ihr einziges
Gotteshaus in Istanbul: eine Schenkung der
Armenier im Stadtteil Tarlabasi. Die syrisch-orthodoxen
Christen waren damals im Osmanischen Reich noch
kein Millet, gegenüber dem Sultan vertrat sie
der armenische Patriarch, der im Namen aller
"Monophysiten" sprach. Erst unter dem
syrisch-orthodoxen Patriarchen Peter IV. (1872
bis 1894) wurde die Kirche als eigenes Millet
anerkannt.
Als amerikanische Missionare im 19. Jahrhundert
den Tur Abdin durchkämmten, lösten sie eine
erste Auswanderungswelle aus. Sie führte nach
Nordamerika, nicht nach Istanbul. Und wer blieb,
sah sein Umfeld durch die Gründung der Republik
Türkei verändert: Das Siedlungsgebiet der
syrisch-orthodoxen Christen wurde zerschnitten,
auch das Band in die nächstgroße Stadt Aleppo.
Und Aufstände der Kurden schafften weitere
Unruhe.
Was unter den damaligen Bedingungen plausibel
erschien, entpuppte sich später als Nachteil:
Die syrisch-orthodoxen Christen dürfen seit
Lausanne keine eigenen Schulen gründen, in denen
sie ihre Sprache und die Sprache von Jesu an die
junge Generation weitergeben können. Sie sind
auf die staatlichen türkischen Schulen
angewiesen. Ohne Sprache aber stirbt eine Kultur.
Was in Lausanne verpasst wurde, soll die EU jetzt
richten.
Der zweite Faktor: Die Angst der Türkei
vor dem Islam
Atatürk, der Begründer der modernen Türkei,
hatte einen unerbittlichen Kampf gegen den Islam
geführt. Er machte ihn für den Niedergang des
Osmanischen Reichs verantwortlich und sprach ihm
ab, mit der modernen Zivilisation vereinbar zu
sein. Alle Religion verbannte er aus dem öffentlichen
Leben, Religionsgemeinschaften konnten sich nur
noch als Stiftungen organisieren. 1925 verbot
Atatürk die einst mächtigen muslimischen Orden.
Um sie zu liquidieren, erließ er 1935 das
Stiftungsgesetz. Die Stiftungen - die
muslimischen, aber auch die nichtmuslimischen -
durften nur noch vorhandenes Eigentum verwalten.
Dazu mussten sie 1936 den Behörden Listen mit
ihren Vermögenswerten vorlegen.
Grundsätzlich gilt: Christen können in der Türkei,
anderslautenden Vorurteilen zum Trotz, ihren
Glauben frei praktizieren. Dennoch unterliegen
sie Einschränkungen und sind sie Sticheleien
ausgesetzt. Einige Beispiele:
1. Atatürk hatte angeordnet, dass in der Türkei
keine Sakralbauten mehr errichtet werden dürften.
Die Muslime haben dieses Verbot erfolgreich
unterlaufen, gegenüber Christen wird es weiter
angewandt. Zeichen einer konzilianteren Gangart
der Behörden sind jedoch zu erkennen. Noch immer
besitzt die syrisch-orthodoxe Gemeinde in
Istanbul, wie im 19. Jahrhundert, nur eine eigene
Kirche. Daneben benutzt sie in Istanbul sieben
Gotteshäuser anderer Glaubensgemeinschaften mit
sowie in Ankara ein katholische Kirche. Die
Benutzung von Wohnungen für Gottesdienste ist
nach dem Wohnungsbaugesetz Nummer 3914 aber
verboten.
2. Sticheleien im Alltag durch Nationalisten und
Ignoranten nehmen zwar ab. Steuerinspektionen
finden dennoch weiter bevorzugt an Weihnachten
statt. Immer weniger Christen tragen wirklich
christliche Namen wie Hanna, Amsih, Mesih. Lieber
nicht auffallen, lautet die Devise. Vor allem als
Rekrut beim Militär.
3. Von der Verkrampftheit im Umgang der Türken
mit ihren Minderheiten passt die Geschichte des
Armeniers Agop Martayan, dem Atatürk den
Ehrennamen Dilacar ("Öffner der Sprache")
verliehen hat und der an der Spitze der türkischen
Kommission zur Sprachreform gestanden hatte. Als
er in den siebziger Jahren starb, berichtete das
Staatsfernsehen lediglich vom "Tod des A.
Dilacar".
Die größten Einschränkungen für die
nichtmuslimischen Minderheiten bringen jedoch das
Stiftungsgesetz von 1935 und die Vermögenslisten,
die sie 1936 vorgelegen mussten. Die Behörden
hatten bis Anfang der siebziger Jahre geduldet,
dass alle Stiftungen neue Immobilien erwarben und
Schenkungen annahmen. Seither hat in der türkischen
Justiz und in der Generaldirektion für
Stiftungen eine Bewegung eingesetzt, jedweden
Stiftungsbesitz zu konfiszieren, der nicht auf
den Listen von 1936 vermerkt war. Betroffen waren
davon auch Immobilien, die deswegen nicht auf die
Listen hatten aufgenommen werden können, weil
die Schenkungsurkunden der Sultane nicht mehr
vorhanden waren.
Der dritte Faktor: Geburtsfehler der
Republik Türkei
Von 1878 bis 1918 hatte das Osmanische Reich 75
Prozent seines Territoriums verloren und 85
Prozent seiner Bevölkerung. Die Republik Türkei
nahm Abschied von der Kulturnation des
osmanischen Vielvölkerreichs, sie definierte
sich jetzt als politisch determinierte
Willensnation. Um diese Willensnation zu
schaffen, wurden Prinzipien benötigt, die zu
Tabus wurden. Zusammengefasst sind sie in den
Prinzipien Atatürks. So zu ihnen gehören:
- Halkcilik (Populismus): Die Gesellschaft ist
homogen, Klassen werden also negiert;
- Milliyetcilik (Nationalismus): Jeder Staatsbürger
ist Türke, eine ethnisch-kulturelle Vielfalt
wird negiert;
- Laiklik (Laizismus): Islam und islamische
Kultur sind Feinde der Türkei, negiert wird jede
Religion;
- Devletcilik (Etatismus): Die führende Rolle
des Staats, konkreter des Militärs, auch der Bürokratie,
negiert wird die Bürgergesellschaft.
Die Geschichte der Türkei ist eine Geschichte
des Aufbegehrens der Ausgeschlossenen gegen diese
Tabus. Damals aber wollte die Türkei als
Willensnation stark sein, kein neues Sèvres
sollte mehr entstehen. Denn in jenem Vertrag von
1920, der in Lausanne aufgehoben wurde, hatten
die Alliierten die Türkei weitgehend unter sich
aufgeteilt. Noch immer sitzt in den Köpfen der
meisten Türken der "Sèvres-Komplex"
fest: Die Furcht, dass es das Ausland nur darauf
anlege, die Türkei zu spalten.
Der Sèvres-Komplex stand auch Pate, als die Türkei
Anfang der siebziger Jahre begann, christlichen
Stiftungsbesitz zu konfiszieren. Auslöser waren
die zunehmenden türkisch-griechischen Spannungen
um Zypern. Opfer dieser seither nicht
korrigierten Politik sind bisher 170
nichtmuslimische Stiftungen geworden. Was einmal
konfisziert ist, ist unwiederbringbar verloren.

Die
syrisch-orthodoxe Kirche ist dabei - für einmal
- weniger betroffen als die "Lausanner
Minderheiten". In Istanbul selbst besitzt
sie über die Stiftung ihrer Bischofskirche
Meryemana Kilisesi lediglich zwei Grundstücke:
auf einem steht die Kirche, die 1849 errichtet
worden ist; das zweite ist das Nachbargrundstück.
Alle anderen Immobilien sind, auch wenn sie der
Gemeinde gehören, auf private Namen eingetragen.
Immobilien, die in Erbschaften der Kirche
vermacht worden sind, wurden mindestens seit den
sechziger Jahren - in weiser Voraussicht - nicht
mehr auf den Namen von Kirchenstiftungen vermacht.
Stärker betroffen ist der Stiftungsbesitz der
Kirche im Tur Abdin. Dort hat jede Kirche
Stiftungsbesitz.
Im vergangenen Jahr gingen sowohl vom armenischen
Patriarchat wie von der syrisch-orthodoxen
Gemeinde Initiativen zur Novellierung des
Gesetzes zu den Stiftungen aus. Einige syrisch-orthodoxe
Gemeindemitglieder erarbeiteten einen
Gesetzentwurf und schickten ihn an zwanzig
Abgeordnete in Ankara. Ziel sollte sein, das
Gesetz von 1935 aufzuheben und den Erwerb von
Eigentum durch die nichtmuslimischen Stiftungen
neu zu regeln. Es solle die Möglichkeit
geschaffen werden, dass die alten Stiftungen in
neue überführt werden und diese Eigentum
annehmen dürfen, schlägt ihr Entwurf vor. Dabei
argumentierten die Gemeindevertreter, dass das
bestehende Stiftungsgesetz im Rahmen der EU-Harmonisierung
novelliert werden müsse. Auf Vorschläge des
armenischen Patriarchats hat das Parlament einen
ersten eigenen Gesetzentwurf nachgebessert.
Zu dem Thema findet auch in den türkischen
Medien eine Diskussion statt. Viele sprechen sich
für Verbesserungen für die Stiftungen aus. Aber
nicht alle. Der stellvertretende Vorsitzende der
konservativen Partei des Rechten Wegs (DYP),
Hasan Ekinci, wandte ein, die christlichen
Minderheiten seien eine Bedrohung für die
nationale Sicherheit. Sie sollten daher nicht
dieselben Rechte genießen wie die muslimischen Türken:
Nur ein Beispiel für das Weiterleben des Sèvres-Komplexes.
Will die Türkei aber nach Europa, muss ihren
nichtmuslimischen Bürgern dieselben Rechte einräumen
wie ihren muslimischen. Die Europäische
Kommission hatte ihren letzten "Fortschrittsbericht"
zur Türkei am 13. November vorgestellt. Dort heißt
es im Kapitel "Bürgerliche und Politische
Rechte", dass die christlichen Kirchen
weiter mit Schwierigkeiten konfrontiert seien,
besonders in der Frage des Eigentums von Vermögen.
Die Türkei hatte in ihrem Nationalen Programm
vom vergangenen März, in dem sie ihre Annäherung
an die EU skizzierte, auf Aussagen zu den Rechten
der Minderheiten verzichtet. Diese Auslassung
geht mutmaßlich auf eine Intervention des
stellvertretenden Ministerpräsidenten und
Vorsitzenden der Partei der Nationalistischen
Bewegung (MHP), Devlet Bahceli, zurück. Er hatte
argumentiert, dass die Türkei mit der Aufnahme
eines entsprechenden Kapitels eingestehen würde,
in der Vergangenheit Fehler begangen zu haben.
Einige Tendenzen zum Besseren sind
auszumachen
Tendenzen zum besseren sind dennoch auszumachen.
Die Behörden des Staats sind um eine Öffnung
bemüht. Einige Beispiele:
(1) Das Diyanet Isleri Bakanligi, die staatliche
Religionsbehörde, gibt sich unter ihrem
Vorsitzenden Mehmet Nuri Yilmaz offener - eine
Tendenz, die der 11. September verstärkt hat.
Das Diyanet spricht von Dialog, lädt andere
Religionen zum Gespräch ein. Vor zwei Jahren
hatte Mehmet Nuri Yilmaz sogar erstmals den Tur
Abdin besucht.
(2) Das Erziehungsministerium hat eine Kommission
eingesetzt. Sie besteht aus 40 Mitgliedern dreier
Religionen und soll ein Unterrichtsbuch für das
Fach "Religion und Ethik" (Din ve Ahlak
Dersi) erarbeiten. Es soll die drei Religionen
vorstellen und zu Toleranz aufrufen. Bisher ist
im Religionsunterricht lediglich der Islam
vorgestellt worden.
(3) Das Tourismusministerium befürwortet die
Renovierung von Kirchen und will den
Religionstourismus fördern, der ohne Kirchen ja
nicht auskommt. Eine "Gefahr der Mission"
sieht das Ministerium nicht.
(4) Nach vier Jahren Arbeit hatte die syrisch-katholische
Kirche, noch in den neunziger Jahren, die
Genehmigung erhalten, eine eigene Stiftung nach
dem Zivilgesetzbuch zu gründen. Stiftungszweck
soll die Ausbildung von Geistlichen sein. Die
Kirche hat sich damit gegenüber der
Generaldirektion für Stiftungen durchgesetzt.
Die hatte argumentiert, es sei grundsätzlich
nicht möglich, eine neue Stiftung mit einem
religiösen Zweck zu gründen. Nur nützt der
syrisch-katholischen Kirche ihr Sieg nicht mehr
viel. Denn die Kirche besteht nur noch aus 150
Familien. Sie haben jetzt das Recht auf eine
Stiftung. Die lohnt sich aber nicht mehr.
(5) Ermutigend ist, wie sich Staatspräsident
Sezer in der Frage der Kirche von Moda für die
syrisch-orthodoxe Gemeinde einsetzt. Sezer hat
auch Ministerpräsident Ecevit und den Istanbuler
Gouverneur Cakir gebeten, der Gemeinde zu helfen.
Sezer demonstrierte damit abermals, dass er ein
Garant für Rechtstaatlichkeit ist und einer der
wenigen wirklich überzeugenden Reformpolitiker
der Türkei.
Was war vorgefallen? Im Osmanischen Reich hatte
es keinen privaten Grundbesitz gegeben. Aller
Grund hatte dem Sultan gehört. Mit einem Ferman,
einem Befehlsschreiben des Sultans, hatte dieser
der französisch-katholischen Gemeinde um 1840
das Grundstück übertragen, um darauf eine
Kirche zu bauen. Erst von 1923 an wurden die
Eigentümer in die neuen Grundbücher eingetragen.
Ausländische Kirchengemeinden konnten jedoch
keinen Grundbesitz haben, weil sie ja keinen
Rechtsstatus hatten, also gar nicht existierten.
Also erhielt die Parzelle keinen Grundbucheintrag.
In den vergangenen Jahrzehnten hatte das
Katasteramt wiederholt Anläufe unternommen, um
das 4000 Quadratmeter große Grundstück dem
Staat zu überschreiben. Der französische Staat
wehrte sich nicht. Denn er versteht sich als
laizistischer Staat. Vor einem Jahr hat das
Schatzamt die Immobilie schließlich übernommen;
es erkannte aber den langfristigen Mietvertrag
an, den die Franzosen mit der syrisch-orthodoxen
Kirche geschlossen hatte. Ein französischer
Rechtsanwalt wollte den Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte anrufen. Die syrisch-orthodoxe
Gemeinde plädierte jedoch für eine Lösung in
der Türkei. Das war wohl richtig.
Über den Generalsekretär des Präsidialamts,
Kemal Nehrozoglu, einen Bürger aus Midyat,
erhielt die Gemeinde innerhalb von zwei Wochen
einen Termin bei Präsident Sezer. Dort trugen
sie ihm vor, wie wichtig die Kirche für sie sei,
die sie seit 1975 mitbenutzten. Bereits drei
Wochen später, am 6.6.2001, besuchte Sezer als
zweiter Staatspräsident der Türkei den Tur
Abdin. Im Deir az-Zafaran informierte er sich über
die Lage und Probleme der syrisch-orthodoxen
Christen. In das Gästebuch des Klosters schrieb
er: "Der Beitrag der aufopferungsvollen,
begabten und staatstreuen Mitglieder der
syrischen Gemeinde für die Entwicklung und
Wohlfahrt der Republik Türkei ist groß. In
diesen Tagen, in denen die Probleme unser südostanatolischen
Region zu Ende gehen und ein neues
wirtschaftliches Programm gestartet wird, wird
dieser Beitrag noch wichtiger."
Das Grundstück in Moda kann das Schatzamt nicht
zurückgeben. Von Sezer hat die Gemeinde bisher
aber die mündliche Zusicherung, dass sie die
Kirche in Moda langfristig benutzen könne, ohne
Miete zahlen zu müssen. Die einzige Bedingung
ist, dass sie die Mitbenutzung durch die französische
Kirchengemeinde nicht aufkündigt. Ein Schriftstück
hat die Gemeinde dazu noch nicht in der Hand.
Aber immerhin die mündliche Zusage des Staatspräsidenten.
Ungelöst ist nach wie vor: Besserung Schule und
Priesterausbildung
Die Blicke der Reformer und der Minderheiten
richten sich auf Sezer. Denn noch immer
blockieren Altvordere in Politik und Bürokratie
Änderungen zum Besseren. Noch immer gibt es
beispielsweise staatliche Schulen, selbst in
Istanbul, deren Schulleiter und Lehrer die
nichtmuslimischen Schüler zwingen, am
muslimischen Religionsunterricht teilzunehmen,
selbst wenn sie ihnen keine Noten geben wollen.
Im Fall des Sohnes eines syrisch-orthodoxen
Freundes hat der Religionslehrer dabei das
Christentum wiederholt sehr scharf angegriffen.
Erst nach dem Militärputsch von 1980 war
Religion als Pflichtfach eingeführt worden. Das
Erziehungsministerium hat am 23. Juli 1990 aber
festgelegt: "Türkische Staatsangehörige,
die nicht eine Minderheitenschule besuchen, können
nicht zur Teilnahme am Religions- und
Ethikunterricht gezwungen werden, wenn sie
beweisen, dass sie einer Minderheit angehören."
Dieser Erlass ist für die syrisch-orthodoxen
Christen von Bedeutung, weil sie ihre Kinder auf
staatliche Schulen schicken müssen. Ihre
Gemeinde hatte vor dem Ersten Weltkrieg in Mardin
eine eigene Schule. 1921 musste sie aus
finanziellen Gründen geschlossen werden. Danach
wurden die Kinder in den Klöstern Mor Gabriel
und Deir az-Zafaran erzogen. Als Minderheit, die
nicht unter dem Schutz von Lausanne steht, kann
die Kirche heute keine eigene Schule einklagen.
Gründungen privater Schulen sind aber selbst für
Muslime nicht leicht. Der Großindustrielle Sakip
Sabanci hatte sieben Jahre gebraucht, um eine
Universität zu gründen.
Daneben kommen die besonderen Bedingungen der Bürgerkriegsregion
im Südosten der Türkei. 1997 hatte der damalige
Gouverneur der Provinz Mardin, Fikret Güven,
gegen Mor Gabriel und Deir az-Zafaran ein
zweifaches Verbot verhängt. Zum einen sollten
sie die Renovierungsarbeiten für die 1600-Jahr-Feier
einstellen. Denn die Baumaßnahmen seien nicht
genehmigt gewesen, sagte er. Das war auch
zutreffend. Die Genehmigungsverfahren bei
denkmalgeschützten Bauten sind in der Türkei
jedoch äußerst langwierig. Zum anderen
untersagte der Gouverneur den Klöstern, Personen
zu beherbergen, die nicht zu den
Klostergemeinschaften gehörten. Das Kloster dürfe
kein Internat mehr sein und es müsse wie ein
Hotel behandelt werden, das seine Gäste der
Polizei zu melden habe, forderte der Gouverneur.
Diese Maßnahme sei im Kampf gegen die Freischärler
der PKK erforderlich, meinte er weiter. Heute übernachten
wieder Schüler und ökumenische Gäste im
Kloster.
Eine private Schule haben die syrisch-orthodoxen
Christen aber weiter nicht. Viele Hürden stehen
im Weg. Zunächst bereitet das 1971 geschlossene
griechisch-orthodoxe Priesterseminar Halki dem
Staat Kopfschmerzen. Eine syrisch-orthodoxe
Schule könnte auch für die Wiedereröffnung von
Halki Präzedenzwirkung haben. Zudem: Wer soll
Schulträger sein? Wer bezahlt die Lehrer? Ist es
nicht zu spät, eine eigene Schule zu gründen?
Erforderlich wäre sie vor einem halben
Jahrhundert gewesen. Heute ist die Gemeinde
klein, vermutlich zu klein für eine eigene
Schule. Nicht alle könnten sich die hohen
Schulgebühren leisten. Zu verstreut leben die
Schüler über Istanbul, als dass ein zentraler
Standort gefunden werden könnte. Der beste Weg
ist also nach wie vor, die sprachliche und religiöse
Grunderziehung über die Klöster zu gewährleisten.
Nach dem Schulabschluss stellt sich die Frage:
Und wo Theologie studieren? Die Türkei verbietet
weiter die Tätigkeit ausländischer Geistlicher.
Auch das hat mit der Angst der Türkei vor dem
Islam und mit dem verkrampften Verhältnis zur
Religion zu tun. Die zwei deutschen Pfarrer in
Istanbul firmieren daher als Angestellte des
Generalkonsulats. Doch der syrisch-orthodoxen
Kirche fehlen Hochschulabsolventen. Wer die
Laufbahn eines Geistlichen einschlagen will, dem
bleibt nur die Alternative: Ausbildung in einem
der Klöster oder ein Aufenthalt von zwei bis
drei Jahren im Patriarchat von Damaskus. Eine
Hochschulausbildung erhält er auch dort nicht.
Der Patriarch schickt Begabte aber ins Ausland,
gegenwärtig nach Rom an die Hochschule des
Vatikan und nach Oxford.
In der Türkei ist die Lage weiter
unbefriedigend, und eine Besserung ist nicht in
Sicht. Der Dekan der Theologischen Fakultät der
Istanbuler Marmara-Universität, Zekeriya Beyaz,
hat jüngst vorgeschlagen, christliche Theologen
in den bestehenden muslimischen Theologischen
Fakultäten ausbilden zu lassen. Dekane dieser
Fakultäten sind Muslime. Seinen Vorschlag begründet
er mit der Furcht vor der christlichen Mission.
Viele Türken teilen sie unverändert mit ihm.
Alle Minderheiten haben den Vorschlag von Beyaz
entschieden abgelehnt.
Wird es eine Rückkehr in den Tur Abdin
geben?
Die Abwanderung ist gestoppt. Wer bisher nicht
weggezogen ist, will bleiben. Eine Rückkehr von
Ausgewanderten gilt in der syrisch-orthodoxen
Gemeinde Istanbuls nicht als eine realistische
Perspektive. Nach Auskunft der Gemeinde liegt
keine konkrete Anfrage für die Rückkehr in ein
Dorf des Tur Abdin vor; auch sei ein konkreter
Wunsch nicht vernommen worden. Ohnehin kaum
realistisch ist eine Rückkehr in die Dörfer,
die im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die PKK
geräumt worden sind. Noch im Mai 2001 konnte der
Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche
Deutschlands, Präses Kock, einige Dörfer nicht
besuchen, die nicht weit von Mor Gabriel entfernt
liegen. Begründet wurde das Verbot damit, dass
in jener Region der türkische Staat die
Sicherheit der Gäste nicht gewährleisten könne.
Eine Rückkehr setzt eine zweifache Sicherheit
voraus: Der Kurdenkonflikt muss gelöst sein und
vom Irak darf keine Bedrohung für die Stabilität
der Region ausgehen. Mit einer gewissen Nervosität
blickt die Regierung in Ankara auch auf das Verhältnis
von Syrern und Assyrern. Zu Syrern und Aramäern,
die sich als religiöse Gemeinschaft definieren
und als Nachkommen des Apostpolischen Sitzes in
Antiochien, hat sie ein unbefangenes Verhältnis.
Das trifft nicht für Assyrer zu, die sich eher
als Volk fühlen, als Nachkommen der Assyrer, die
in Mesopotamien geherrscht hatten, bevor die
Araber und später die Türken in die Region
eindrangen. Bei den Assyrern vermutet die Türkei
ein politisches Anliegen. Ihr Bezugspunkt ist
Mesopotamien. Sie sprechen von der Unterdrückung
in ihrer Heimat und von einem Kampf für die
Freiheit. Teilweise hängen sie sich an die
Kurden. Die türkische Regierung, die die
Terrororganisationen PKK und Asala überstanden
hat, ist nicht gerade scharf darauf, mit den
Assyrern eine neue Flanke zu eröffnen.
Andererseits dürfte es nach Aussage von
Gemeindemitgliedern in Istanbul für Rückkehrwillige
auch nicht leicht sein, ihr Eigentum zurückzuerhalten.
Viele haben es verkauft, andere haben es in der
Erwartung einer endgültigen Ausreise ihrem
muslimischen Nachbarn zur Verwahrung oder
Benutzung gegeben. Sie sagten: "Ich gehe
nach Deutschland, kann es nicht verkaufen, nimm
es." Grundbücher sind durchaus vorhanden.
Letztlich werden die Gerichte in Einzelfällen klären
müssen, wer Eigentum geltend machen kann. Dabei
wird das Gericht wird prüfen, ob ein Verkauf
stattgefunden hat, und wer über die Jahre
Steuern auf das Land und das Haus bezahlt hat.
Andererseits sei es ein positives Zeichen, dass
der Staat versprochen habe, Eigentum zurückzugeben,
sagt ein Istanbuler Gemeindemitglied.
Eine Massenrückkehr aus Europa in den Tur Abdin
schließe ich aus. Bei den einen stehen dem
wirtschaftlichen Gründe entgegen, bei anderen
die Beschwerlichkeit des Lebens. Wieder andere
haben Angst, wie in der Vergangenheit, oder sie
haben kein Vertrauen in die Zukunft der Türkei.
Zurückkehren könnten indes ältere Menschen, für
die das Leben im Westen zu schwierig und zu
schnelllebig geworden ist, die vom alten Leben träumen.
Die Jugend aber kann man nicht zurückbringen,
und in den Dörfern leben nur noch die Alten.
Fazit
Einer der ersten, der sich für einen EU-Beitritt
der Türkei ausgesprochen hatte, war der ökumenische
Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus I.
Seit seiner Wahl zum Oberhaupt der orthodoxen
Weltkirche verficht er die These, dass die
Christen in der Türkei und auch sein
historisches Patriarchat nur dann Überlebenschancen
haben, wenn sich die Türkei an europäischen
Normen ausrichtet.
Eine Umwandlung in eine demokratischere Türkei
hat eingesetzt. Heute gibt es weniger Sticheleien
gegen Christen. Das hat damit zu tun, dass es
weniger Christen gibt, aber auch damit, dass die
junge muslimische Generation toleranter ist als
ihre Väter. Verändert hat sich auch die
Blickrichtung. Früher hatte die Konfliktlinie
geheißen: Muslim versus Giavur, also Ungläubiger.
Heute heißt sie: säkular versus
fundamentalistisch.
Auch wenn die Türkei europäisch wird und sich
europäisch verhält - meine Prognose lautet:
Selbst der Restbestand von knapp anderthalb
Promille Christen an der Bevölkerung wird weiter
schwinden. Denn die christlichen Jugendlichen
heiraten immer mehr muslimische Partner. Wenn
Christen nicht Christen heiraten, hat das auch
damit zu tun, dass Eltern Heiraten über die
Klassengrenzen hinaus oft nicht zustimmen. Reich
heiratet eben nicht arm. Daneben erhalten die
Jugendlichen immer mehr Anregungen von der Außenwelt
und werden die Reize der Großstadt Istanbul
wichtiger als die Möglichkeiten des
Gemeindelebens.
Es wird immer schwieriger, die Gemeinde zu
erhalten. Das Spiel ist aus, das Ziel der
jahrzehntelangen Diskriminierung erreicht. In der
Stadt, die einst den Namen Konstantins getragen
hatte, gibt es kaum mehr einen Kostas. Noch vor
einem Jahrhundert war auf dem Boden der heutigen
Türkei jeder vierte Einwohner kein Muslim
gewesen. Das bunte Mosaik früherer Reiche ist
einem fugenlosen türkisch-muslimi schen Wand-
und Bodenbelag gewichen.
|
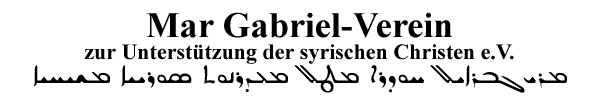
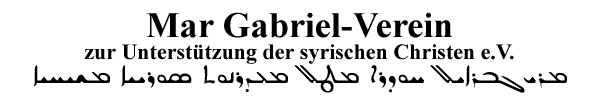
![]()